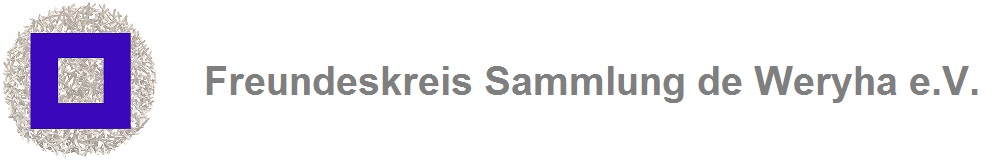Trotz aller Unterschiede in Herkunft und Arbeitsweise der Teilnehmer findet man durchaus Verbindendes in den Werken. Durchgehend fallen zwei Ausdrucksqualitäten besonders ins Auge: Fast überall steht entweder die Form oder aber das Material im Vordergrund, und oft genug das Wechselspiel beider. Das klingt für plastische Bildwerke erst einmal trivial, aber machen wir uns klar, was alles keine wichtige Rolle spielt (oder nur ausnahmsweise): etwa die natürliche Darstellung von Personen und Dingen; anekdotische Bilderzählungen, Niedliches und Gemütvolles; gestischer Ausdruck und persönliche Handschrift; Farbe als Ausdrucksträger; dekoratives Ornament. All das könnte man erwarten, alles gibt es hier und da, aber die Mehrzahl der Arbeiten lebt von Problemen der Form und des Materials.So sehr, dass manches auf den ersten Blick vielleicht sogar etwas spröde und unpersönlichwirkt; dieArbeiten brauchen Zeit, um ihre inneren Gesetzmäßigkeiten zu begreifen. Ein zweiter Blicklohnt sich! Diese Vorherrschaft von Form und Material erinnert sicherlich nicht zufällig an Jan de Weryhas eigene Werke. Und tatsächlichsieht sein „Lehrplan“ vor, dass jeder erst einmal lernt, wie man im Ton modelliert und anschließend die Form in Gips überträgt. In der Formfindung ist man im Prinzip frei – allerdings ermutigt Jan zur Vereinfachung und vorallem zur Abkehr von allzu konkreten Gegenstandsbezügen. „Lass die Form noch einbisschen offen, leg dich noch nicht auf ein Ding fest!“ sind seine typischen „Korrekturen“, das höchste Lob lautet: „Das hat Kraft!“ Figürliches Arbeiten ist möglich, aber man muss es sich erkämpfen. Ich erinnere mich, wie mich einmal jemand beiseite nahm und in etwas betroffenem Tonfall sagte: „Deine Köpfes ind ja nicht schlecht, und wir haben ja auch alle mal so angefangen – aber meinst Du nicht, du könntest langsam die nächste Stufe erklimmen?“ Ich arbeite daran… Nach dieser ersten, auch technischen Übung sind alle frei, ihre eigenen Projekte zu verfolgen – und auch, ihre eigenen Materialien mitzubringen. Und das ist die zweite Lektion der weryhanischen Lehrplans: jedem (wirklich jedem!) Material, jedem Ding die ihm innewohnenden Strukturen und Ausdruckswerte abzulauschen und durch möglichst sparsame Bearbeitung zur Geltung zu bringen. Während einige immer wieder zu eher neutralen und formbaren Materialien wie Gips und Beton zurückkehren, suchen Andereden Reiz des Gewachsenen im Holz oder Stein; den technischer Artefakte, die ihre Funktion verlorenhaben; den des schon Gestalteten in Spielzeug und Oblaten; oder den des Zerstörten und Weggeworfenen.
Um dies kurz an den Exponaten zu konkretisieren: Auf der Seite der reinen plastischen Form haben wir einerseits geometrische und technisch – konstruktiv wirkende Arbeiten wie die von Ulrike Gütersloh, Christine Sammann und Lucy Idsenga – Eckstein (entfernt klingendabei dieKlassiker der abstrakten Moderne wie Brancusi oder Billan); anderer seits eher organische Formen, stark abstrahierte Figuren und Köpfe wie bei Gisela Meister, Kathrin Strampe, Andrea Purk oder Ulrike Gütersloh (manches erinnert an die frühen Skulpturen von Hans Arp). Auffällig häufig wird dabei der Gegensatz von Körper und Leerraum thematisiert, etwabei Muzna Malik, Jürgen Fagin und bei Winfried Heinrich, der uns etwa zugleich mit einer plastischen Birne und birnenförmigen Hohlräumen konfrontiert; dabei bilden jene Leerräume einen Sonderfall, die sich quasi von selbstaus dem Stehenlassen der Gips-Negativform ergeben, wie im Durchblick vonKathrin Strampe und den modularen Relief – Serien von Nicole Mattern und Ute Marglowski. Auf der Materialseite wird das Extrem markiert durch das fast oder ganz unbearbeitete Fundstück, etwa die Holzobjekte von Ingrid Fraser oder Birgi tWahrenburg – Jächnkes Teller mit Steinen und Oblaten. Ein überraschender Eindruck ergibt sich dabei manchmal aus derKombination der Stücke, oder auch aus der Art ihrer Verbindung, wie bei Christine Sammann und Brigitte Schoderer. Andere bearbeiten die Stücke mehr oder wenigerstark (wie ChristianeKortüm ihr hölzernes Ungeheuer), oder collagieren sie zu ganz neuen, teils surrealen Bildern (wie Reinhard Sauer, Rudi Walter undGisela Büttner). Man erkennt Verfahrensweisen der Arte povera, wie sie auch für Jan de Weryha große Bedeutung haben. Es gibt freilich auch die Verbindung von Fundstücken und geformtem Gips, besonders konsequent durch dekliniert von Gisela Müller, die allerlei Objekte (etwa die gezeigten Glas-Splitter) in den Gipseinbettet, aber auch bei Andrea Madadi, die für ihre Nester umgekehrt Gipsformen in große Baumscheiben einfügt. Einen Sonderfall markiert die Arbeit vonTherese Ziesenitz-Albrecht, die das Gipsfragment eines Gesichtes mit einem Holzstück zueinem rätselhaften Fetischobjekt verbindet. Schließlich gibt es noch Arbeiten, die das – letzlich unkontrollierbare – Zerbrechen der Form zum Ausdrucksmittel machen: etwa Nicole Matterns kleine Risse – Tafeln oder Kathrin Strampes erwähnten Durchblick, eine Art gewaltiger Schädel,der aus Fragmenten abgeschlagener Gipsformen besteht. Überhaupt fällt auf, wie viele der Materialarbeiten (aber auch der figürlichen!) von Beschädigung und Kontextverlust künden, und wie oft die künstlerische Gestaltung nur als letzter Schritt eines viel umfassenderen Prozesses wirkt, als eine letzte Station auf dem Lebensweg der Objekte.So könnte man Zeitlichkeit oder Prozessualität vielleicht noch als heimliche Dritte hinzufügen zu den Ausdrucksqualitäten Form und Material. Biographien und Werke – einige Beispiele: Die Frage nach der Biographie der Dingebringt uns nun natürlich auch zur Frage nach ihren Urhebern, danach, wie möglicher weise die Gestalt und die Lebensreise der Dinge mit der Lebensreise der Künstler zusammenhängen. Hier ist nicht der Raum für 25 Künstlerviten, aber Schlaglichter sollen zumindest auf einige Teilnehmer dieser Ausstellung fallen. Da sind zum Beispiel die zwei großen Specksteinarbeiten von Jürgen Fagin: räumlichkomplexe Gebilde, die man stundenlang von allen Seiten betrachten kann. Wirken sie auf denersten Blick noch sehr technisch, entpuppen sie sich bei näherem Hinsehen einmal als belebte Kippfiguren voller Gesichter, Figuren und Körperglieder, dann wieder als phantastischeLandschaften mit Wegen und Durchbrüchen, die erkundet werden wollen. Wer Jürgen Fagin einmal zugesehen hat, wie er mit einer ganzen Batterie von Werkzeugen ein Detail nach dem anderen aus demStein herausarbeitet, ohne je den Überblick zu verlieren, der ahnt, welche handwerkliche Kompetenz hier am Werk ist. Tatsächlich ist Jürgen gelernter Elektroniker, hat früher komplizierte Schaltmodulegebaut und später die Verkabelung ganzer Passagierflugzeuge organisiert. Nun ist der Techniker ganz an die funktionellen Anforderungen gebunden und muss vor allem da kreativ werden, wo der Konstrukteur etwas nicht richtig durch dacht hat – augenscheinlich ganz anders als in der Kunst. Doch Jürgen sieht keinen so großen Unterschied: „Hier höre ich auf das, was der Stein mir sagt.“ Und das ist ziemlich wörtlich gemeint: Jürgen macht sich kein Konzept. Solange der Stein nicht zu ihm spricht, wird kein Handschlag getan. Aber früher oder später spricht der Stein, und dann entstehen die Formen wie von selbst, Stunde um Stunde, Woche um Woche, nicht selten einganzes Jahr lang. Und jede Woche hat der Stein sich wieder völlig verändert, ohne dass er zwischendurch freilich jemals unfertig gewirkt hätte. Die faszinierend – vielschichtigen Objekte lassen sich zumindest teilweise aus ihrer langwierigen und komplexen Entstehungsgeschichte erklären. Das gegenteilige Vorgehen sehen wir bei Christine Sammann, die sich als Ingenieurin erst einmal ein Gipsmodell des unversehrten Specksteines gemacht hat. Daran konnte sie die Formgebung erproben, die dann akkurat auf den Stein übertragen wurde. Die ausgestellten Versionen von Steps in Gips und Stein sind im Übrigen auch ein besonders reizvolles Beispiel für die Dialektik von Form und Material, die durch solche Übertragungsprozesse deutlich zutage tritt. Wie für Jürgen Fagin ist das langsame, intuitive Arbeiten auch für Muzna Malik von großer Bedeutung. Die beiden zunächst rätselhaften Gipsarbeiten behandeln das Thema der Spatial Memories, der räumlichen Erinnerungen, mit dem sie sich schon seit ihrem Architekturstudium in Pakistan beschäftigt. Ausgangspunkt ist die Struktur der traditionellen pakistanischen Häuser, die Muzna teils aus ihrer eigenen Erinnerung, teils auch aus den Erzählungen von Verwandten und Freunden kennt. So offenbart der große Gipskubus in seinem Inneren eine Raumstruktur, die an ein solches Wohnhaus denken lässt; die kleinteilige zweite Plastik geht einen anderen Weg, indem sie die eigentlich begehbaren Räume selbst in massive Körper umwandelt, soals hätte man ein Haus mit Gips ausgegossen und dann die Bausubstanz selbst entfernt. Dies erinnert an das berühmte House von Rachel Whiteread, die genau das 1993 mit einem echten Haus in London getan hat; doch anders als bei Whiteread, deren Arbeit sie kennt und bewundert, geht es für Muzna Malik niemals um die reale Architekturform, sondern immer um den idealen Raum, der aus unserer Erinnerung erwächst.Ihre neueren Arbeiten sind folgerichtig Strickbilder aus Wolle, die durch das sensiblere Material und den langsameren Arbeitsprozess der Natur des Erinnerns entgegen kommen. Einige dieser Werke – diesmal über ein altes Bergedorfer Haus – sind übrigens zeitgleich unterwegs zu einer Ausstellung in Pakistan. Wenn Muzna Malik die Erinnerungen erst zu Objekten gerinnen lässt, sind bei Reinhard Sauer vielmehr die vorgefundenen Dinge Erinnerungsträger. Die bizarren Portraitfiguren Napoleon und Josephine bestehen bei näherem Hinsehen aus allerlei rätselhaften Metallteilen. Sie entpuppen sich auf Nachfrage als Reste von teils sehr altenlandwirtschaftlichen Geräten, die Reinhard in Chile, in der Gegend um Osorno, gesammelt hat. Dazu muss man sagen, welche zentrale Bedeutung Chile für Reinhard Sauers Biographie, besonders die künstlerische, hat. Als junger Mann träumte Reinhard davon, Künstler zu werden; doch als ersich an derHamburger Kunsthochschule bewerben wollte, überzeugte ihn kein Geringerer als Gotthard Graubner von den großen Risiken einer Künstlerlaufbahn. Reinhard wurde Lehrer, aber während seiner Lehrtätigkeit in Südamerika fand er, nun zumindest finanziell abgesichert, zur Kunst zurück und studiertein Los Lagos Bildhauerei, zuletzt als Meisterschüler von Osvaldo Thiers. Im Lauf der Jahre entwickelte Reinhard großes Talent, überall auf der Welt alte, mit Erinnerungen aufgeladene Artefakte aufzuspüren-und sich mit viel Charme anzueignen-, die er dann in seinem Atelier auf Gut Wotersen zu tiefsinnig – humorvollen Skulpturen verarbeitet. Ein noch radikaleres Beispiel für die verborgene Bedeutung der Dinge ist Brigitte Schoderers Assemblage Dem Himmel so fern, in der sich ein benutzter Pinsel, eine alte Dachschindelder Petrikirche und ein Stück Schnur zu einem rätselhaften Epitaph für den verstorbenen Künstler und Journalisten Rüdiger Knott verbinden, dessen Materialfundus die Stücke entstammen. Wie Reinhard Sauer war auch Gisela Büttner Lehrerin und viele Jahre damit betraut, Jugendliche auf den Ernst des Lebens vorzubereiten; dem gegenüber erscheinen ihre Werke allerdings bemerkenswert unseriös und provokant. Arbeitet Reinhard bevorzugt mit Gegenständen, die das Geheimnis einer fernen Vergangenheit umgibt, so greift Gisela aufganz alltägliche Dinge zurück, speziell auf solche, die zunächst billig und trivialwirken: Metallschrott, Elektrobauteile, Dekomaterial und billiges Spielzeug, wie man es in 1-€-Läden bekommt. Mit ihnen treibt sie ein anarchisches Spiel, das alle Regeln des bildungsbürgerlichen Geschmacks lustvoll ignoriert; und doch verbergen sich in ihren absurden Objekten immer wieder hintersinnige Kommentare zum Zustand unserer Welt. Wenn sie uns mit Whiter Shade of Relax etwa eine Gruppe von Plastikhasen zeigt, die augenscheinlich sehr glücklich in einemComputergehäuse gefangen sind, liegt es nahe, eine Kritik an der allgegenwärtigen medialen Sedierung zu vermuten. Oder vielleicht doch eine erotische Phantasie für die Generation Tinder? Giselas Drang, künstlerisch die Enge des Alltags zu überwinden, wenn auch in ganz anderer Form, verbindet sie schließlich mit Irene Gerdes, die als eine von wenigen hier durchgehend figurativ arbeitet. Exemplarisch ist dafür ihr Odyssee-Zyklus: Die sieben Reliefs thematisieren die jahrelangen Irrfahrten des Helden, der jedoch selbst nur in einer der Szenen erscheint; im Mittelpunkt stehen die Frauengestalten, denen er begegnete – wobei auch die Göttin Athene und eine Sirene als Frau-Vogel-Mischwesen auftauchen, nicht jedoch die unglücklich zurück gelassene Penelope. Die Formensprache wirkt archaisch, und die vielfach gebrochenen Gestalten verweisen darauf, dass nicht nur Odysseus selbst auf seiner Lebensreise manche Schramme davontrug. Unschwer erkennt man Bezüge zum Leben der Künstlerin, das bestimmt war und ist durch den Ausbruch aus der Enge ihrer Heimat und die Suche nach dem geistigen Zuhause. Nach ihrem Studium an der HfbK führte ihr Weg sie durch ganz Europa, und man sieht ihren Arbeiten an, dass besonders die versunkenen Kulturen des Mittelmeeres ihr zur ideellen Heimat wurden. In ihren Jahren auf Sizilien entstanden keramische Arbeiten, die der Antike so nahestanden, dass die Käufer Zertifikate über Irenes eigene Urheberschaft verlangten – aus Angst, sonst als Antikenschmuggler zugelten. Und bis heute wirken die Werke von Irene Gerdes mit ihren mythologischen Sujets, ihrer geheimnisvollen Patina, ihren kleinen und großen Brüchen oft so, als hätten sie jahrtausendelang in der Erde gelegen – was freilichaktuelle Bezüge nicht ausschließt: Ganz frisch gebrannt ist der kleine Stier, der Verso Europa galoppiert und uns nachdenklich macht, wohin wohl er Europa tragen wird… Um auf den Anfang zurückzukommen: Ich denke es wird deutlich, in wie unterschiedliche Richtungen die gezeigten Werke Jans Anregungen entwickeln; vor allem aber, dass viele der Arbeiten gerade nicht von Kunststudenten hätten stammen können. Sie alle wachsen auf dem Nährboden individueller Kompetenzen und Erfahrungen – Berufserfahrungen, Begegnungen, gelebten Lebens. Dies schmälert nun freilich nicht die Leistung des „Pädagogen“ Jan de Weryha. Vielleicht ist sogar das sein größtes Talent: uns zu helfen, unsere eigenen Begabungen klarer zu sehen, ins besondere aber auch unsere eigenen Themen zu finden, die wir alle ja im Grunde längst mitbringen. Und vielleicht erklärt das – zumindest ein kleines Stück weit – die Besonderheit und die Qualität der Arbeiten, die wir hier sehen.
Autor: Heiner Schmalfuß